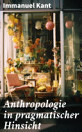Kritik der reinen Vernunft
Immanuel Kant
জুলাই ২০২২ · Project Gutenberg
৫.০star
৩ টা পৰ্যালোচনাreport
ইবুক
758
পৃষ্ঠা
family_home
যোগ্য
info
reportমূল্যাংকন আৰু পৰ্যালোচনা সত্যাপন কৰা হোৱা নাই অধিক জানক
এই ইবুকখনৰ বিষয়ে
Kritik ist nicht als Beanstandung, Tadel oder Herabwürdigung zu verstehen, sondern im ursprünglichen Sinn des griechischen Wortes κρίνω krino, Infinitiv krinein „scheiden, unterscheiden, beurteilen“ als Analyse und Überprüfung im weitesten Sinne. Die KrV trennt dabei die Beiträge der reinen Vernunft zur Erkenntnis von der Spekulation, deren Wahrheitsgehalt nicht feststellbar ist. Der Genitiv (der) kann sowohl als genitivus objectivus wie als genitivus subjectivus gelesen werden, also als eine Kritik an der Vernunft und durch die Vernunft. Als oberstes Erkenntnisvermögen kann sich die Vernunft selbst zum Gegenstand einer Selbstkritik machen. Kant spricht vom „Gerichtshof der Vernunft“ (B 779), vor dem die Vernunft Kläger, Angeklagter und Richter zugleich ist. Die reine Vernunft umfasst nach Kant die Fähigkeit des menschlichen Denkens, Erkenntnisse ohne Rückgriff auf vorhergegangene sinnliche Erfahrung zu erlangen. Rein ist das Erkenntnisvermögen, wenn es keine bestimmte Erfahrung voraussetzt, sondern nur mit Vorstellungen arbeitet, die das Subjekt in sich selbst vorfindet oder erzeugt. Diese Erkenntnisse sind a priori, da ihre Wahrheit ohne Überprüfung in der Erfahrung feststellbar ist. Der Erkenntnisapparat des Subjektes im Sinne der Kritik der reinen Vernunft umfasst die Sinnlichkeit als das Vermögen der Anschauung, den Verstand als das Vermögen, Anschauungen unter (einfache) Begriffe zu bringen, sowie die Vernunft im Allgemeinen als das Vermögen, die Verstandeserkenntnis zu ordnen; als das Vermögen, nach Prinzipien zu denken. Damit bedeutet der Buchtitel: Überprüfung der Möglichkeiten der Erkenntnisfindung ohne Verwendung der Erfahrung und Beschränkung der Erkenntnis auf das ihr Zugängliche. Oder wie Kant es ausdrückt: „Was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis?“
মূল্যাংকন আৰু পৰ্যালোচনাসমূহ
৫.০
৩ টা পৰ্যালোচনা
লিখকৰ বিষয়ে
Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg, Preußen; † 12. Februar 1804 ebenda) war ein deutscher Philosoph der Aufklärung. Kant zählt zu den bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie. Sein Werk Kritik der reinen Vernunft kennzeichnet einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte und den Beginn der modernen Philosophie. Kant schuf eine neue, umfassende Perspektive in der Philosophie, welche die Diskussion bis ins 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst. Dazu gehört nicht nur sein Einfluss auf die Erkenntnistheorie und Metaphysik mit der Kritik der reinen Vernunft, sondern auch auf die Ethik mit der Kritik der praktischen Vernunft und die Ästhetik mit der Kritik der Urteilskraft.
এই ইবুকখনক মূল্যাংকন কৰক
আমাক আপোনাৰ মতামত জনাওক।
পঢ়াৰ নির্দেশাৱলী
স্মাৰ্টফ’ন আৰু টেবলেট
Android আৰু iPad/iPhoneৰ বাবে Google Play Books এপটো ইনষ্টল কৰক। ই স্বয়ংক্রিয়ভাৱে আপোনাৰ একাউণ্টৰ সৈতে ছিংক হয় আৰু আপুনি য'তে নাথাকক ত'তেই কোনো অডিঅ'বুক অনলাইন বা অফলাইনত শুনিবলৈ সুবিধা দিয়ে।
লেপটপ আৰু কম্পিউটাৰ
আপুনি কম্পিউটাৰৰ ৱেব ব্রাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি Google Playত কিনা অডিঅ'বুকসমূহ শুনিব পাৰে।
ই-ৰীডাৰ আৰু অন্য ডিভাইচ
Kobo eReadersৰ দৰে ই-চিয়াঁহীৰ ডিভাইচসমূহত পঢ়িবলৈ, আপুনি এটা ফাইল ডাউনল’ড কৰি সেইটো আপোনাৰ ডিভাইচলৈ স্থানান্তৰণ কৰিব লাগিব। সমৰ্থিত ই-ৰিডাৰলৈ ফাইলটো কেনেকৈ স্থানান্তৰ কৰিব জানিবলৈ সহায় কেন্দ্ৰত থকা সবিশেষ নিৰ্দেশাৱলী চাওক।