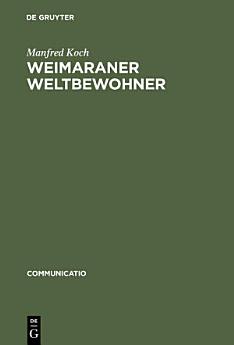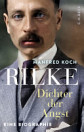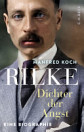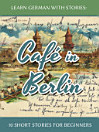Weimaraner Weltbewohner: Zur Genese von Goethes Begriff >Weltliteratur
About this ebook
Die Arbeit versucht, Goethes fragmentarisches Weltliteraturkonzept so zu rekonstruieren, daß seine drei wichtigsten Dimensionen – historische Diagnose, moralischer Appell und klassizistische Poetik der Moderne – gleichgewichtig zur Geltung kommen. Dazu wird im ersten Teil jene Theoriedebatte des 18. Jahrhunderts umrissen, die die Bildung des Begriffs ‚Weltliteratur‘ in der Sattelzeit ermöglichte: die Anerkennung kultureller Verschiedenheit in der Philosophie der Aufklärung (Montesquieu u.a.); die Diskussion über die heraufziehende Weltgesellschaft bei Autoren wie Rousseau, Adam Smith und Kant; die Überlegungen Herders und Humboldts zum Prozeß ‚nationalliterarischer‘ Besonderung und interkultureller Verflechtung. Der zweite Teil verfolgt anhand exemplarischer Texte die Genese von Goethes Weltliteratur-Begriff in drei Schritten: von den als Reaktion auf die Französische Revolution entstandenen »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« (1795) über den »West-östlichen Divan« (1814–19) bis hin zu Goethes Weltliteratur-Publizistik der zwanziger Jahre in seiner Zeitschrift »Über Kunst und Altertum«.