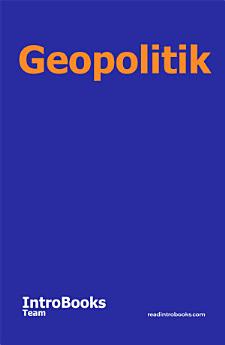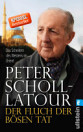Geopolitik
Über dieses E-Book
Im Herbst 1989 war es schwer zu glauben, dass sich in der globalen Landschaft etwas Monumentales abspielte. Die Regungen in Osteuropa waren keine Einzelfälle, sondern schienen Teil eines größeren Prozesses zu sein - dessen Verlauf noch ungewiss war. Als Doktoranden an der Universität Oxford hatten viele Zeugen dieser historischen Ereignisse gestanden, und als am 9. November die Bilder von Ostdeutschen, die an der Berliner Mauer herumhackten, über den Fernsehbildschirm blitzten, sprangen alle mit einigen an Bord eines Fluges nach Berlin von ihren Klassenkameraden aus erster Hand die Dekonstruktion eines Reiches zu bezeugen.
Als alle am nächsten Tag ankamen, war die Partyatmosphäre entlang der Mauer explodiert. Lufthansa-Flugbegleiter mit Tabletts verteilten Häppchen an die Versammelten, und US-Fernsehmoderatoren, die gerade von ihrer Überseereise gekommen waren, wurden auf provisorische Plattformen gehievt, um „live von der Szene“ zu berichten. Der klügste westliche Beobachter dieser berauschenden Tage, der britische Journalist und Schriftsteller Timothy Garton Ash, bezeichnete diese Zeit im November als die „größte Straßenparty in der Geschichte der Welt“. Und so war es.
Es wurde geschätzt, dass am Wochenende nach dem Mauerfall fast zwei Millionen Ostdeutsche nach Westberlin kamen - die meisten von ihnen, um das Willkommensgeschenk von 100 Mark auszugeben, das sie von der westdeutschen Regierung erhalten hatten. Die Beobachter kamen mit ihrem eigenen, mit Graffiti bemalten Stück Mauer und dem euphorischen Gefühl, im Zentrum der Geschichte zu stehen, nach Hause. Der Zusammenbruch kommunistischer Regime war so schnell, dass sich Wissenschaftler und Journalisten bemühten, Schritt zu halten.
Die Revolutionen, die in Polen und Ungarn begonnen und sich auf Deutschland ausgeweitet hatten, lösten in der Tschechoslowakei, in Rumänien und in Bulgarien Umwälzungen aus. Die Welle breitete sich schließlich auf die Sowjetunion selbst aus, wo der unterdrückte Nationalismus im Baltikum - Estland, Lettland und Litauen - und in Republiken wie Armenien und Georgien zu Forderungen nach Unabhängigkeit explodierte. Die sich verschlechternde sowjetische Wirtschaft verstärkte nur diese nationalistischen Gefühle und veranlasste aufeinanderfolgende konstituierende Republiken der Sowjetunion, ihre eigenen Wirtschafts- und Rechtssysteme zu schaffen.
Obwohl der Geist bereits aus der Flasche war, versuchten kommunistische Hardliner im Kreml, die Veränderungen rückgängig zu machen, indem sie im Sommer 1991 einen Putsch gegen Präsident Michail Gorbatschow inszenierten. Die Bemühungen wurden vom Präsidenten der russischen Republik, Boris Jelzin, vereitelt - mit Hilfe der Armee - aber das kommunistische Regime in Moskau wurde tödlich verwundet. Jede verbleibende Autorität war schnell verflogen. Die Sowjetunion wurde am 26. Dezember 1991 offiziell aufgelöst und beendete ihre Regierungszeit als größter und einflussreichster kommunistischer Staat der Welt.
Als Folge des Sieges und der Verbreitung der liberalen Demokratie, sagte er voraus, würden die traditionelle Machtpolitik und die großen Konflikte nachlassen und der Weg zu einer friedlicheren Welt. Ein Jahrzehnt später ging das Ende des Kalten Krieges und die anschließende Zunahme der Zahl der liberal-demokratischen Staaten in der Tat mit einem deutlichen Rückgang sowohl der zwischenstaatlichen als auch der ethnischen Kriege sowie der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen einher. Das war erst der Anfang von allem.